
Gedenkveranstaltung
Hervorgehoben

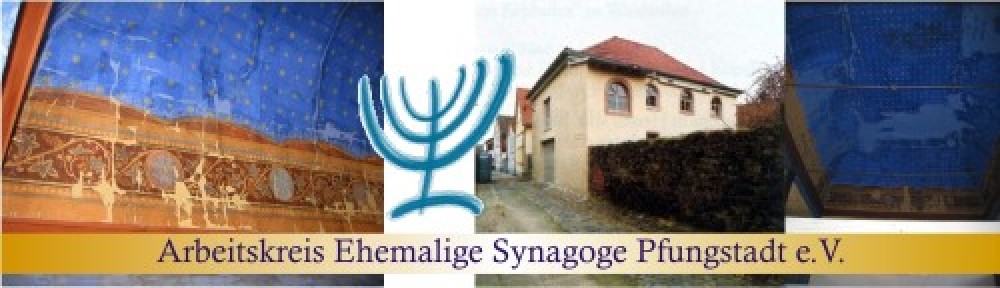

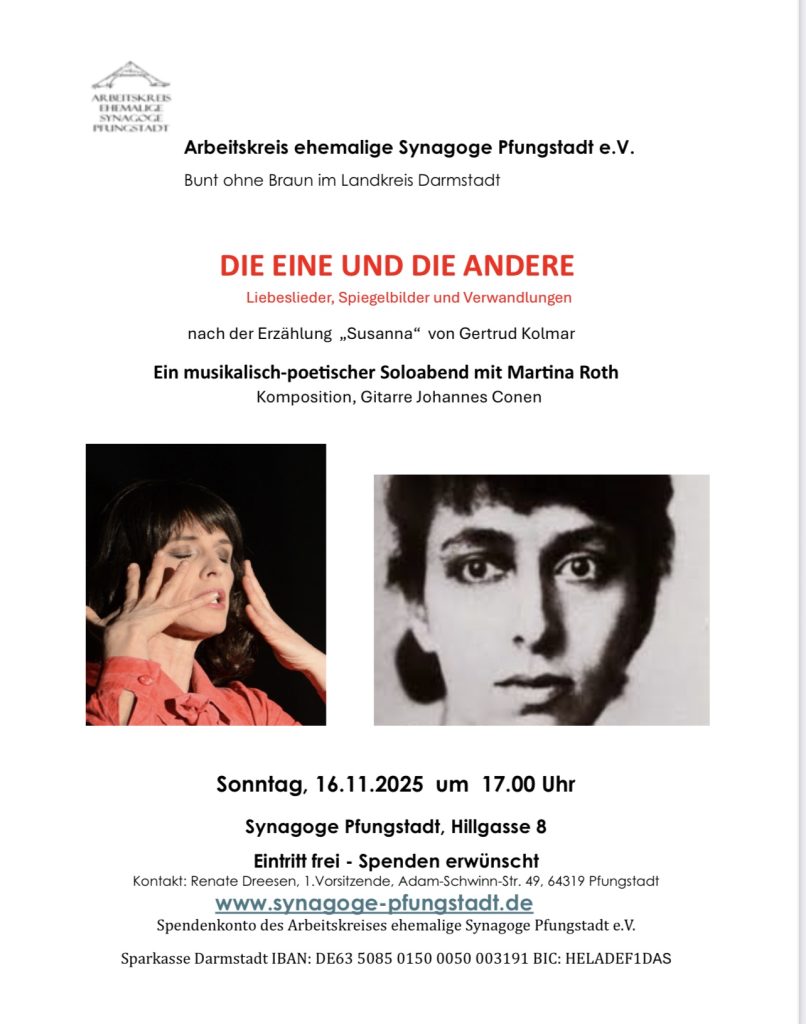
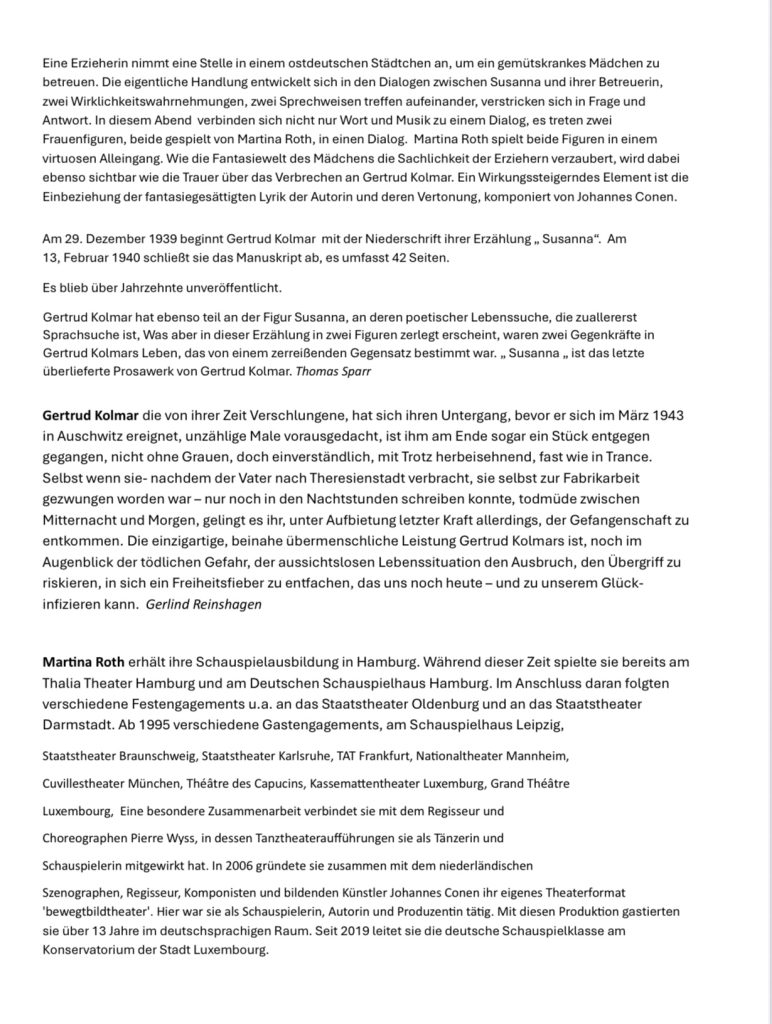
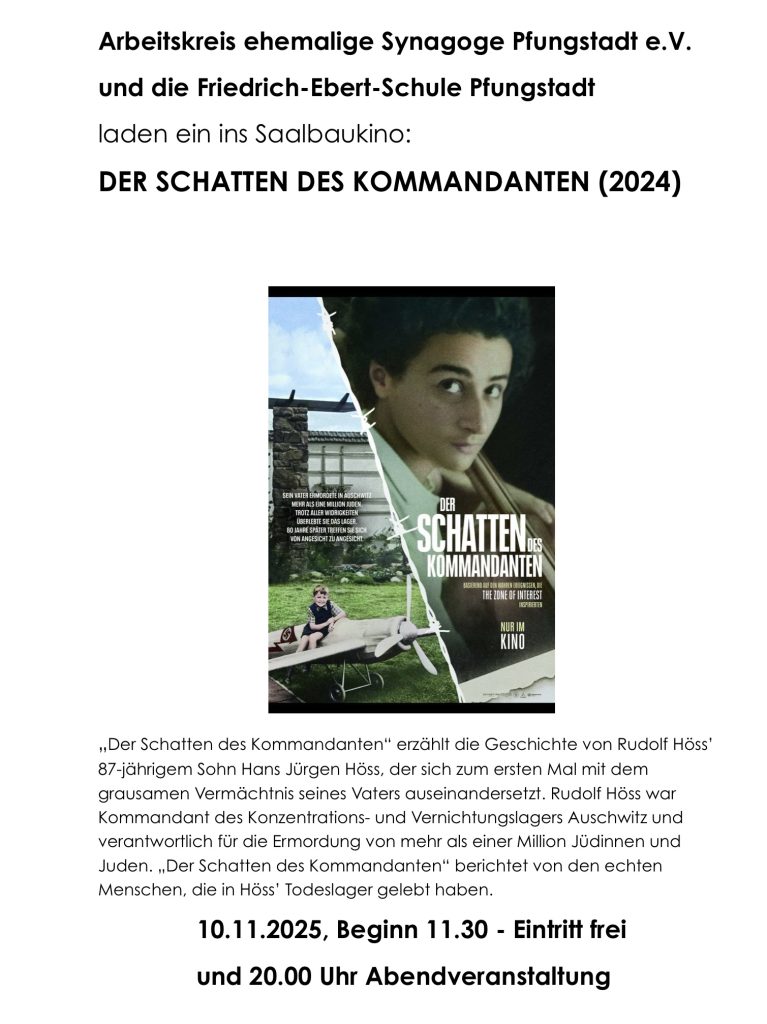
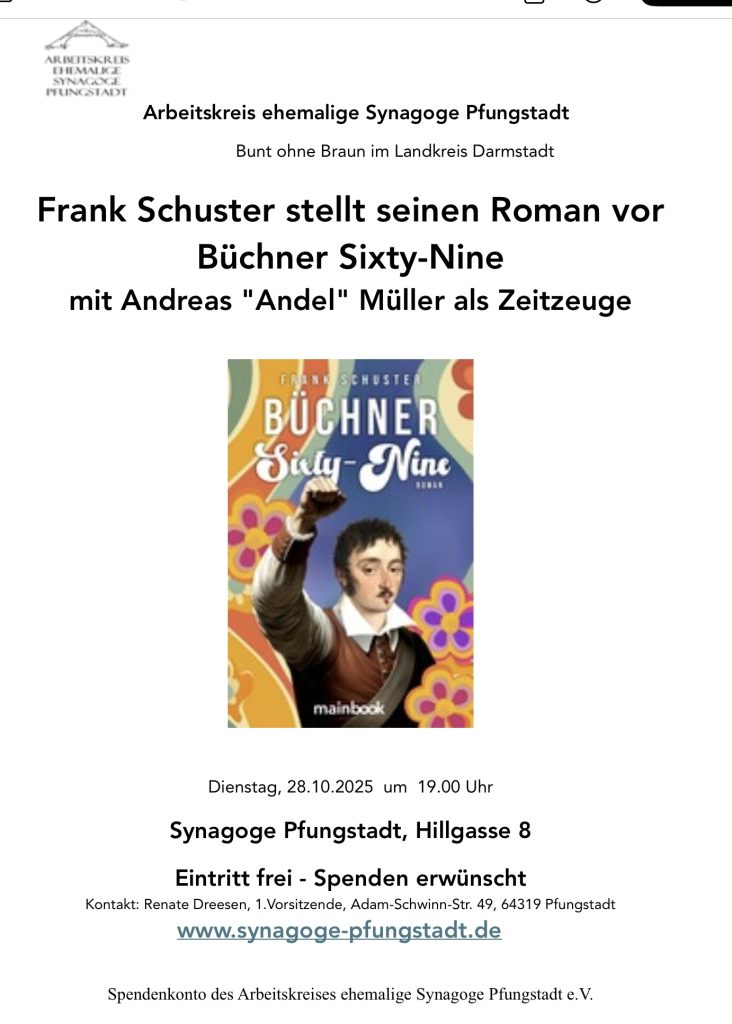
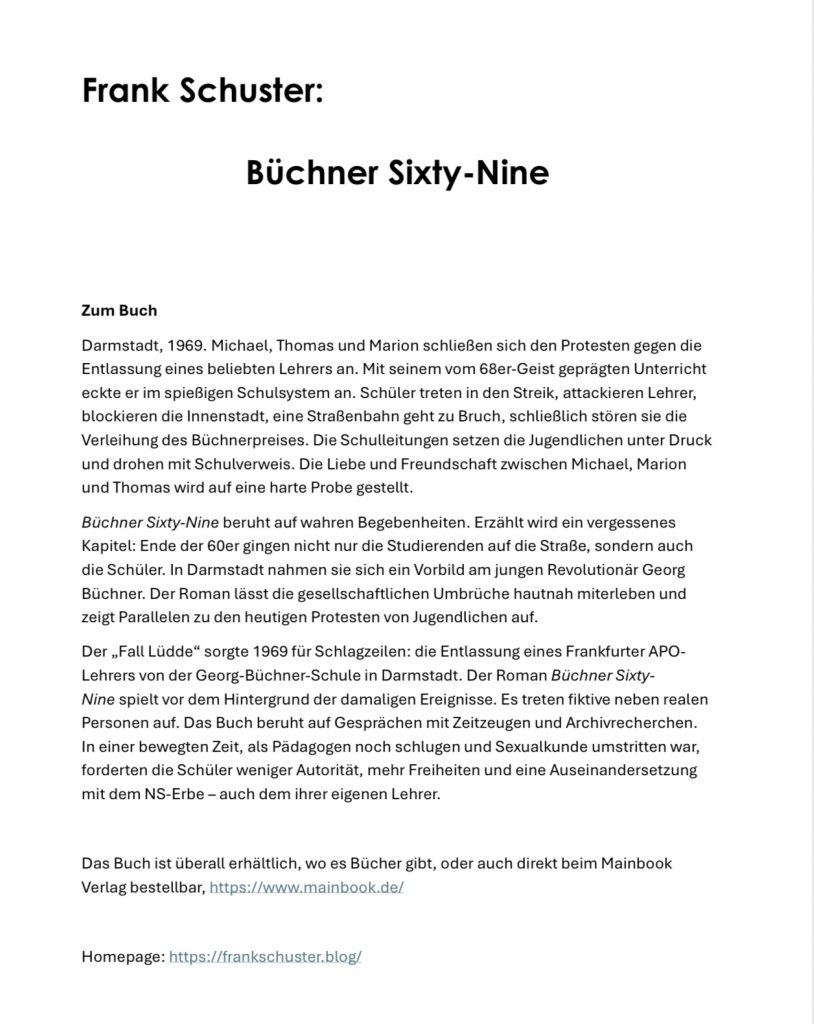




Wir trauern um Renate Knigge-Tesche – eine langjährige Kämpferin für Demokratie und
prägende Gestalterin der Erinnerungskultur in Hessen. Sie war bis 2012 Leiterin des
Referats III der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mit großer Kompetenz und
Engagement organisierte sie die jährlichen Gedenkstättentreffen sowie regelmäßige
Fahrten zu Gedenkorten im Herbst, in Deutschland, auch nach Polen, in die
Niederlande und nach Osterreich.
Jedes Frühjahr fanden dreitägige Seminare in Hessen statt zu verschiedenen
Themen zur NS-Zeit, hervorragend vorbereitet und mit ausgewiesenen
Expertinnen zu diesen Themen. Mehrseitige Literaturlisten und Materialen
dienten der Vorbereitung für die Teilnehmenden.
Frau Knigge-Tesche begleitete darüber hinaus Ruth L. David, Jüdin aus Fränkisch-
Crumbach, bei ihren Besuchen in Deutschland und organisierte Lesungen an
Schulen und anderen Orten. Sie übersetzte Ruth Davids Lebenserinnerungen
und publizierte die Briefwechsel mit Eltern und Familie.
Renate Knigge-Tesche unterstützte die Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft der
Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Hessen, publizierte eine
Broschüre zu den Gedenkstätten und Erinnerungsorten und sorgte dafür
zusammen mit ihrem Mitarbeiter Joachim Heuer, der leider ebenfalls bereits
verstorben ist – für die Darstellung der Gedenkstätten auf der Internetseite der
Hessischen Landeszentrale.
Wir danken Renate Knigge-Tesche für ihre Unterstützung und ihr
Engagement und werden sie in ehrender Erinnerung behalten.

Barbara Zeizinger: Leben in Etagen
Im Zentrum dieses facettenreichen Romans steht ein Haus, das 1931 von der jüdischen Familie Blum bezogen wird. Drei Generationen einer anderen Familie folgen, denn die Handlung erstreckt sich in vier Kapiteln bis in die Gegenwart.
Da sind zu Beginn Simon und Therese, die zunehmend unter Antisemitismus und dem aufkommenden Nationalsozialismus zu leiden haben. Im zweiten Kapitel steht Luise im Mittelpunkt. Sie muss nicht nur mit den Herausforderungen der Nachkriegszeit in der zerstörten Stadt, sondern auch mit der Verbitterung ihres Ehemanns Hermann über den verlorenen Krieg fertig werden. Und da gibt es noch den Amerikaner Mike. Er spielt eine größere Rolle, als ihm bewusst ist.
In den Siebzigerjahren bauen Erwin und Susanne das Haus um. Als Susanne dabei bestimmte Unterlagen ihrer Mutter findet, beginnt sie das Leben ihrer Eltern zu erforschen. Im letzten Kapitel müssen sich Frieda und Paul mit einigen Krisen ihrer Ehe und ihres Sohns Alex auseinandersetzen. Als sie schließlich nach einigem Zögern das Haus beziehen, scheint sich der Kreis zu schließen. Bis sie ein Brief erreicht.
Die handelnden Personen und das Haus sind literarische Erfindungen. Die dargestellten historischen Ereignisse haben allerdings stattgefunden und sind die Folie, vor der sich das Leben der Familien ereignet. Es geht um die Fragen, inwiefern gesellschaftliche Verhältnisse das Leben der Protagonisten beeinflussen, ob sie sich denen entziehen können und welchen Einfluss eine Generation auf die nächste nimmt.